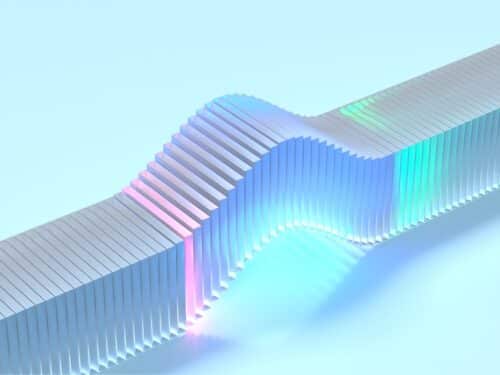Wer schon einmal jemanden beim Fensterreinigen in schwindelerregender Höhe beobachtet hat, weiß: Das sieht ziemlich gefährlich aus. Wie groß das Risiko wirklich ist, zeigt sich beim Blick auf die Versicherungen. Menschen in diesem Beruf zahlen einen vergleichsweise hohen Beitrag für eine Berufsunfähigkeitsabsicherung. Auch Dachdecker oder Pilotinnen müssen für die Police tief in die Tasche greifen. Für Sprengberechtigte oder auch Rennsportlerinnen und Profirennfahrer sieht es noch schlechter aus: Sie haben oftmals kaum Aussichten darauf, überhaupt eine private Absicherung zu erhalten – ihre Jobs sind einfach zu risikoreich.
Natürlich können auch Personalverantwortliche solche gefährdeten Berufsgruppen nicht grundsätzlich vor Unfällen oder Stress bewahren. Sie können jedoch sehr wohl dafür sorgen, dass die Beschäftigten optimal auf ihre Rolle vorbereitet sind. Das beginnt mit einer soliden Ausbildung, fachlichen Schulungen, Sicherheitsunterweisungen und Gesundheitsangeboten.
HR und Führungskräfte müssen die Risiken, denen die Menschen ausgesetzt sind, nicht nur verstehen, sondern auch steuern. Dazu gehört zum Beispiel, bestimmte Verhaltensregeln festzulegen: Was passiert, wenn es doch einmal zu einem Unfall kommt? Wer trägt die Verantwortung für einen herausfordernden Einsatz? Welches Risiko darf eingegangen werden und welches nicht? Die Antworten auf diese Fragen hängen naturgemäß von der jeweiligen Branche und dem Tätigkeitsfeld ab. Eines ist aber für alle gleich: Sind Angestellte einem Risiko ausgesetzt, braucht es klare Regeln und eine vertrauensbasierte Unternehmenskultur.
Wie das in der Praxis funktionieren kann, berichten Fluglotsin Damaris Schröder und Winden-Operator Sebastian Schneider.
Flugsicherung:
Die Fluglotsin am Radarschirm„Als Fluglotsin höre ich das Wort Risiko natürlich gar nicht gerne. Wir sprechen von Verantwortung. Seit fünf Jahren verantworte ich einen Luftraum östlich des Frankfurter Flughafens, in dem viele Anflüge geführt werden. Ich arbeite als sogenannte Centerlotsin in der Kontrollzentrale, das heißt, ich überwache alle Flieger, die in meinem Bereich in der Luft sind. Zu Spitzenzeiten sind das schon mal zwölf Flugzeuge gleichzeitig. Ich führe die Flugzeuge, deren genauen Standort ich auf dem Radarmonitor sehe, durch meinen Luftraum. Am Flughafen übernehmen dann Tower-Lotsinnen und -Lotsen, sie geben die Starts und Landungen der Maschinen frei.
Die Verantwortung trage ich natürlich nicht alleine. Wir arbeiten immer zu zweit. Eine Person sitzt am Radarschirm und kommuniziert mit dem Cockpit im Flugzeug. Direkt nebendran sitzen die Koordinationslotsinnen und -lotsen und informieren die benachbarten Lufträume, wenn einer unserer Flieger beispielsweise in einer anderen als der geplanten Höhe in einen angrenzenden Luftraum einfliegen wird. Im Einsatzplan sehe ich, welche Position ich wann ausfülle – wir sind für beide Rollen ausgebildet.
Mein rund achtstündiger Arbeitstag hat viele Pausen. Die brauche ich auch, damit ich stets voll konzentriert arbeiten kann. Nach maximal zwei Stunden am Stück mache ich mindestens 30 Minuten Pause. Dann gehe ich spazieren, lese oder esse etwas. Manche von uns machen in ihren Pausen Sport. Für uns steht Sicherheit an oberster Stelle. Deshalb gelten auch strenge Regeln: Wir müssen die Pausen penibel einhalten. Und nur, wer hundertprozentig fit ist, kommt zur Arbeit. Wache ich morgens beispielsweise mit Kopfweh auf, bleibe ich daheim.
Ich bin mir meiner Verantwortung jederzeit bewusst. Aber sie belastet mich nicht, im Gegenteil. Fluglotsinnen und -lotsen brauchen räumliches Vorstellungsvermögen, Nervenstärke und natürlich Verantwortungsbewusstsein. Die Ausbildung hat mich darauf vorbereitet, auch in komplexen Situationen besonnene Entscheidungen zu treffen. Das begann schon mit dem Einstellungstest: Nur fünf Prozent der Bewerberinnen und Kandidaten schaffen es überhaupt durch den Test. Im ersten Jahr übt man sämtliche Situationen im Simulator. Anfangs ist das recht einfach: Im Luftraum fliegt eine Maschine, die man lotsen muss. Dann kommen zwei Flieger, später kreuzen sich die Wege in der Luft. Erfahrene Fluglotsinnen und -lotsen betreuen uns in diesem Ausbildungsabschnitt und geben uns Feedback.
Danach geht es schon an den späteren Arbeitsplatz: Hier sitzt die Ausbilderin oder der Ausbilder immer direkt daneben. Anfangs hatte ich beispielsweise Schwierigkeiten, Sprechfunk mit starkem Akzent zu verstehen. Im Sommer ist es sehr herausfordernd, wenn plötzlich eine Gewitterzelle auftaucht und Maschinen diese Gebiete umfliegen. Wer in der Luft ist, kann da nicht einfach so weg. So etwas kann man im Simulator nur bedingt trainieren. Die Praxisphasen in der Ausbildung dauern unterschiedlich lang. Es geht bei uns nicht um Schnelligkeit, sondern um Sicherheit. Daher gibt es für die Dauer der praktischen Ausbildung keine strengen Zeitvorgaben. Der individuelle Fortschritt ist entscheidend, bei Unsicherheiten kann das Training verlängert werden.
Es fällt mir leicht, in meinem Job ruhig und gelassen zu bleiben, denn ich habe stets einen Plan B im Kopf. Wir werden auch immer nur für einen Luftraum ausgebildet. Meiner ist ein Dreieck: Frankfurt – Nürnberg – Stuttgart. Der deutsche Himmel ist in viele verschiedene Lufträume unterteilt, wie ein Puzzle. Ich kenne in meinem Luftraum jeden Flugplatz, alle Streckennetze und die angrenzenden Lufträume. Jeden Morgen schaue ich am PC nach etwaigen Änderungen, manchmal ist ein Flugplatz gesperrt oder eine Wegeführung ändert sich. Ich bin Spezialistin – und das muss ich auch sein, denn Komplexität hat auch ihre Grenzen.
Fluglotsinnen und -lotsen haben einen eigenen Tarifvertrag und verdienen im Schnitt 120.000 Euro im Jahr. Diese Vergütung spiegelt unsere Verantwortung wider. Die Deutsche Flugsicherung ist sich der Verantwortung bewusst – und prüft alle Beschäftigten auf Herz und Nieren. Alle zwei Jahre muss ich mein Wissen testen lassen. So stellt die DFS Deutsche Flugsicherung sicher, dass ich der Verantwortung immer noch gewachsen bin. Alle drei Jahre geht es für mich zudem zum medizinischen Check. Komme ich mit dem Druck noch klar? Sehe und höre ich einwandfrei? Nur dann wird meine Lizenz verlängert. Die meisten in unserem Beruf verlassen ihren Arbeitsplatz mit Mitte 50. Deshalb dürfen wir auch höchstens 24 Jahre alt sein, wenn wir die Ausbildung beginnen – sonst lohnt sich die aufwendige und wertvolle Ausbildung nicht.“
Damaris Schröder, Centerlotsin bei der DFS Deutsche Flugsicherung in Langen

Worauf muss HR bei diesem risikoreichen Job achten?
Nelson Taapken, Partner bei EY im Bereich People Advisory Services, kommentiert:
- Der Beruf ist hochgradig stressig und wird deshalb entsprechend vergütet. Alles muss präzise und unter enormem Zeitdruck passieren. Streng geregelte Arbeits- und Pausenzeiten sind hier die wichtigsten HR-Instrumente. Fluglotsinnen und -lotsen haben zudem abhängig von Einsatzort und Schichtdienstplanung jährlich rund 35 Urlaubstage.
- HR muss gerade in solchen Berufen ein Arbeitsumfeld schaffen, das die Beschäftigten entlastet, etwa mit einer Kinderbetreuung oder Pflegeunterstützung.
- Personalverantwortliche können die Verantwortung nicht reduzieren, sie können aber sehr wohl dafür sorgen, dass die Lotsinnen und Lotsen ihrer Aufgabe gewachsen sind – durch regelmäßige Weiterbildungen und durch mentales Training. Auch Angebote der Gesundheitsförderung halten die Beschäftigten fit und gesund.
- Wichtig ist eine Kultur des Vertrauens und der offenen Kommunikation. Kommt eine Person nicht zur Arbeit, weil sie sich unwohl fühlt, muss sie unbedingt in dieser Entscheidung bestärkt werden. Beschäftigte sollten sagen können, wenn es ihnen zu viel wird. Dafür braucht es großzügig geplante Vertretungsregelungen, damit immer genügend Personal zur Verfügung steht.
Luftrettung:
Der Windenretter im Helikopter„Mein Leben hängt nicht nur sprichwörtlich an einem Seil. Ich bin Winch Operator, bediene also Rettungswinden am Hubschrauber. Damit können wir Menschen aus unwegsamem Gelände retten und sie medizinisch versorgen. Mit der Winde bringe ich Notarzt und Luftretter der Bergwacht sicher zum Boden, während der Helikopter über der Einsatzstelle kreist.
Wer sagt, Multitasking geht nicht, hat noch keinen Winch Operator erlebt. Während ich bei offener Tür auf der Kufe des Helikopters in der Luft stehe, muss ich das Gelände unter mir und auch rund um den Hubschrauber sondieren: Wo können wir unser Personal abseilen? Währenddessen muss ich den Piloten oder die Pilotin präzise einweisen, dass genau die richtige Stelle angeflogen wird. Erst dann lasse ich das bis zu 90 Meter lange Stahlseil hinunter. Bei mir muss jeder Handgriff sitzen.
Ich arbeite immer im Team, mit Pilotinnen oder Piloten, dem Notarzt oder der Notärztin und Rettungsfachkräften, vor allem der Bergwacht. Wenn wir zum Einsatzort fliegen, sitze ich neben dem Piloten und unterstütze diesen bei der Navigation. Dort angekommen, mache ich die Seilwinde bereit, seile die Notärztin ab und bringe sie mitsamt der verletzten Person wieder an Bord. Dann koordiniere ich, in welche Klinik wir fliegen, und setze mich wieder ins Cockpit. Die Konzentration müssen wir über einen langen Zeitraum halten, immerhin geht unser Arbeitstag bis zu 15 Stunden und 30 Minuten.
Mein Team und ich sind Risiken und Gefahren ausgesetzt, die wir jedoch mit unserem Risikomanagement kalkulieren und einordnen können. Deshalb treffen wir die Entscheidung, ob wir einen Einsatz durchführen oder nicht, immer gemeinsam: Wenn wir jemanden aus steilem Gelände retten, müssen wir natürlich das Risiko einer Lawine oder eines Steinschlags einkalkulieren. Diese Gefahrensituationen sind da, wir müssen deshalb genau wissen, wie wir damit umgehen. Bei Lawinengefahr schaue ich mir etwa die Schneemenge, das von der Lawinenkommission ausgegebene Lawinenrisiko und die Hangneigung an. Dann mache ich eine klassische Risikoanalyse: Wie wahrscheinlich ist es, dass der Worst Case eintritt? Dann treffe ich meine Entscheidung. Jedes Teammitglied darf für sich entscheiden, am Ende legen wir alle unsere Karten auf den Tisch. Wenn nur eine Person im Team dagegen ist, machen wir es nicht.
Heldentum hat bei uns nichts zu suchen. Jeder Arbeitstag beginnt mit einer morgendlichen Besprechung, in der wir über unser jeweiliges Befinden sprechen. Ist jemand gerade Vater oder Mutter geworden und das Baby hat die Nacht oft geweint? Oder kann sich jemand heute nicht gut konzentrieren? Wir arbeiten dafür gerne mit einem Glas, das wir mit grünen oder roten Murmeln befüllen. Wenn ich mich sehr wohl fühle, ausgeschlafen bin und alles gut läuft, werfe ich nur grüne Murmeln hinein. Für jedes Wehwehchen oder jede Sorge, die mich plagt, stattdessen eine rote. Am Ende sehen wir, wie leistungsfähig wir als Team heute sind, und können entscheiden, welche Rettungsaktionen wir durchführen und welche nicht.
Schon in der Ausbildung werden Winch Operator für mögliche Gefahren sensibilisiert. Ich bin selbst verantwortlich für die Ausbildung der Besatzungen an den Windenstationen der DRF Luftrettung in Bautzen, Freiburg und Nürnberg und lege darauf großen Wert. Wer Winch Operator werden will, muss belastbar und stressresistent sein. Die kognitiven Fähigkeiten testen wir anhand verschiedener Methoden. Eine Woche lang bilden wir den Nachwuchs theoretisch aus, schaffen Bewusstsein für mögliche Gefahrensituationen. Dann geht es ans Trockentraining am Hubschrauber, gefolgt von zwölf Flugstunden. Ich setze dabei auf eine gute Mischung aus Fehler machen lassen und eingreifen. Immerhin arbeite ich mit Menschen und nicht mit einem Rohstoff. Alle haben unterschiedliche Lernprozesse und Fähigkeiten, die es zu berücksichtigen gilt. In der Ausbildung lernt der Nachwuchs auch die wichtigste Kompetenz in unserem Job: Vertrauen. Denn nur wenn wir uns gegenseitig vertrauen können, arbeiten wir sicher und können unsere Mission erfüllen: Menschenleben retten.“
Sebastian Schneider, Ausbildungsleiter Winde und Winch Operator bei der DRF Luftrettung

Worauf muss HR bei diesem risikoreichen Job achten?
Nelson Taapken, Partner bei EY im Bereich People Advisory Services, kommentiert:
- Personalverantwortliche können Gefahrensituationen nicht verhindern, sie müssen aber dafür sorgen, dass ihre Beschäftigten damit sicher umgehen und adäquate Entscheidungen treffen können.
- Gerade in Rettungsberufen ist psychologische Unterstützung immens wichtig. HR muss sich genau überlegen, was Einzelne brauchen, und entsprechende Angebote bereitstellen.
- Teams, die eigenverantwortlich entscheiden, brauchen starke Führungskräfte. Können die Teammitglieder aus Fehlern lernen? Werden ihre Entscheidungen respektiert, einen Einsatz nicht anzutreten? Nur dann kann Vertrauen entstehen.
- Bei langen Arbeitstagen muss HR genau auf die Arbeitszeitregelung schauen. Pausen sind wichtig, denn nur so bleibt die Konzentration erhalten.
Dieser Beitrag erschien zuerst in der gedruckten Ausgabe Risiko. Das Heft können Sie hier bestellen.