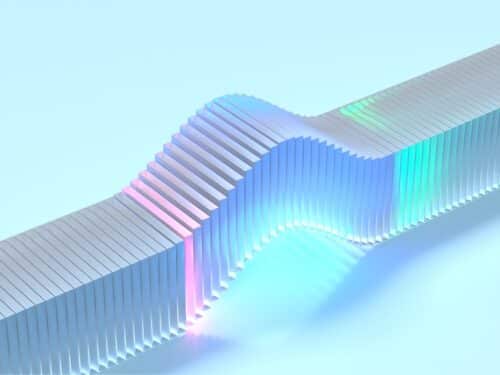Begeisterung sei eine Bringschuld des Unternehmens, sagt Michael Vogler. Der Berater befasst sich in seiner Arbeit mit der Bedeutung von Organisationskultur. Ein Gespräch über Mainstream-Denken in der Wirtschaft, mangelndes Engagement und die Bedeutung von Gemeinsamkeit.
Michael Vogler und seine Kollegen nennen sich Kulturdesigner, nicht einfach Unternehmensberater. Es geht ihnen darum, ein Bewusstsein für Unternehmenskultur und die darin enthaltenen Prozesse zu schaffen. Sie sollte gezielt gestaltet werden. Im Interview merkt man Vogler eine gewisse Lust am Querdenken an. Gängige Managementpraktiken stellt er auf den Prüfstand und holt dafür weit aus – bis weit in die Geschichte der Wirtschaftstheorie. Der sympathisch wirkende Vogler hat viel zu erzählen – das aber immer ruhig und überlegt. In mehr als zwanzig Jahren Organisationsentwicklung hat er eine Menge erlebt. Sein Eindruck ist, dass sich die Einstellung der Menschen zur Arbeit in den vergangenen Jahren völlig verändert hat.
Herr Vogler, so ein Begriff wie der der inneren Kündigung, ist das für Sie ein Modewort?
Na ja, das Wort gibt es ja schon lange. Sicherlich seitdem ich arbeite. Aktuelle Untersuchungen dazu zeigen, dass die Anzahl derjenigen, die innerlich gekündigt haben, stetig wächst. Wir reden aktuell von fast jedem vierten Arbeitnehmer. Da wird einfach nicht drauf reagiert, das ist Wahnsinn.
Wie interpretieren Sie den Begriff?
Wir haben es mit einer Epidemie des mangelnden Engagements zu tun. Die Menschen lieben ihre Arbeit nicht mehr. Überall sieht man deutlich, dass sich die Einstellung zur Arbeit vollkommen geändert hat. Nehmen wir das Beispiel Siemens oder Krupp: Dort zu arbeiten, das war mal was. Da ist eine ganze Welt mitgeschwungen. Heute wird Arbeit reduziert auf Jobs. Da geht es darum, schnell und mit wenig Aufwand viel Geld zu verdienen, nicht aber darum, eine Identität zum Arbeitgeber oder zu Kollegen aufzubauen.
Auch früher waren bestimmt nicht alle Arbeitnehmer immer hochmotiviert bei der Sache.
Es war definitiv anders früher. Bevor es den Bruch in der Wirtschaftstheorie gab, ab den 70er Jahren, mit Margret Thatcher, Ronald Reagan und den Chicago Boys. Ab da wurde das wirtschaftliche Denken auf reine Zahlenorientierung, mit Blick auf die Shareholder, reduziert. Anfang der 90er hat dies dann nochmal richtig an Kraft gewonnen und man hat geradezu vorsätzlich die Leute vergessen, von denen wir alle leben. Die Leute, die die Arbeit machen. Dazu kamen die Veränderungen durch die Computer. Dadurch wurden die Alten, die diese neue Sprache nicht verstanden haben, von den Jungen abgehängt. Die Jungen fühlten sich dann als Sieger und Vertreter der Wahrheit. Das Denken aber haben sie zunehmend Algorithmen überlassen.
Das klingt sehr pauschal. Gehen Sie da nicht zu harsch mit den Managern ins Gericht?
Natürlich kann und darf man nicht alle Führungskräfte über denselben Kamm scheren. Ich kenne sehr viele sehr engagierte Führungskräfte. Mir hat sogar letztens die Finanzchefin eines international agierenden Unternehmens gesagt, dass das ständige Starren auf die Kostenstruktur die Menschen übergehen würde. All ihre Bemühungen, im Konzern auf die Folgen hinzuweisen, blieben ungehört. Es sei deshalb unausweichlich, dass das sinkende Engagement auf die Finanzsituation massiv durchschlagen werde.
Warum dringt sie nicht durch mit ihrer Botschaft?
Weil sich eben vielfach eine Art des Denkens eingeschlichen hat, in der der Mensch überhaupt nicht mehr vorkommt. Und das ist zu einer Art Generalfolie wirtschaftlichen Handelns geworden. Mir geht es – in aller Überspitzung – darum, die vielfach einseitige Ausbildung und das Mainstream-Denken in der Wirtschaft aufzuzeigen und Wege zu öffnen, um anders zu denken. An der Wirtschaftsuniversität Wien gab es in diesem Frühjahr sogar Proteste von BWL-Studenten gegen diese Einseitigkeit. Das war ein Lichtblick.
Die heute Jungen ticken also anders?
Ja, sie sind ganz anders und das ist für uns Ältere manchmal überraschend. Vor einiger Zeit hatte ich ein Gespräch mit meinem Sohn, er ist Jahrgang 1990. Er sagte, dass alle um ihn herum Angst hätten. Dieses ständige Krisengerede gebe ihnen das Gefühl, dass ohnehin alles sinnlos sei. Ich spreche auch sehr viel mit anderen Eltern über dieses Thema. Wir machen nahezu alle die Beobachtung, dass die Jungen der Generation Y, auch teilweise die von X, sich materiell einschränken können. Daher glaube ich, nicht übertrieben optimistisch zu sein, wenn ich sage, dass die Jungen vor allem Gemeinsamkeit und Lebenssinn erleben wollen. Meine Generation ist darin bei weitem nicht so gut.
Ihr Ansatz ist die bewusste Gestaltung der Unternehmenskultur. Deren Rolle für erfolgreiches Wirtschaften wird nun aber auch nicht erst seit Kurzem diskutiert. Warum ändert sich trotzdem nur so langsam etwas in den Unternehmen?
Das stimmt. Gerade seit 1995 gibt es enorm viel Literatur, beispielsweise „Emotionale Intelligenz“, „Emotionale Führung“ oder „Kostenfaktor Angst“, solche Sachen. Das hatte aber keine Wirkung. Vielmehr ging das einseitige Denken ungebremst weiter. Es hat uns in die Krisen der letzten Jahre geführt. Das eigene Denken zu ändern stellt Menschen, die im Mainstream groß geworden sind und in ihm Karriere machten, jetzt vor ein riesiges psychologisches Problem. Sie müssten sich eingestehen, dass sie nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems waren. Das verlangt eine irre persönliche Größe. Solche Unternehmer und Führungskräfte gibt es und es werden immer mehr. Insgesamt aber geht die Änderung in der real existierenden Wirtschaft nur langsam vor sich. Für diejenigen, die jetzt umdenken, bieten sich unglaubliche Chancen.
Nochmal zurück zum Ausgangspunkt: Warum muss man überhaupt Leidenschaft und Begeisterung für seine Arbeit empfinden? Wird da der Begriff der Arbeit nicht maßlos überladen?
Erst einmal ist Begeisterung eine Bringschuld des Unternehmens. Das hat klare betriebswirtschaftliche Gründe: Leute, die ihre Arbeit mögen, die darauf Lust haben, bringen die beste Leistung. Das wissen wir nicht nur aus zig Studien, sondern auch aus eigener Erfahrung. Wir vergessen zu oft, dass Menschen lebende Wesen sind, die gewisse Voraussetzungen brauchen. Das sind gar nicht so viele: Sie müssen gedeihen können, sie müssen Selbstachtung entwickeln können, und sie sind – biologisch gesprochen – Rudeltiere. Unsere Natur präferiert Gemeinsamkeit im Team. Das alles zu erfüllen, ist kaum mehr möglich.
Was heißt das für die Unternehmenskultur?
Menschen bilden immer bestimmte Kulturen aus, in denen Sichtweisen und Beurteilungsmodi geteilt werden. Und wenn Menschen so sind, muss ich mir als Unternehmen die Frage stellen, welche Kultur ich haben will. Tatsächlich findet sich in den meisten Unternehmen eine Opferkultur. Da hilft kein Seminar, das Mitarbeiter auffordert, aus ihrer Komfortzone herauszukommen – das triebe sie noch mehr in die Opferhaltung. Solche Mitarbeiter sind überhaupt nicht mehr produktiv im Sinne des Unternehmens. Sie verbrauchen einen Großteil ihrer Energie mit der Suche nach Schuldigen für ihre Misere und zu ihrer Verteidigung. Um das zu ändern, muss das Unternehmen gelebte Gemeinsamkeit bieten, denn das ist es, was sie in erster Linie suchen.
Ist das auch der Grund, warum so viele Mitarbeiter in einem unglücklichen Arbeitsverhältnis verharren?
Ja, denn wir Menschen brauchen die Gemeinschaft. Als Individuum kann ich nur meinen Lebenssinn entwickeln, wenn ich für andere etwas tue. Da sind wir zunächst auf einer ganz tief menschlichen Ebene: Ich brauche andere. Und die finde ich unter anderem auf der Arbeit. Im guten Fall wird Mitarbeitern dort echte Gemeinschaft angeboten. Auf diesem guten Boden erst kann menschliche Leistung gedeihen. Im schlechten Fall hält man es unglücklich und unengagiert aus, so lange es die Gesundheit zulässt.
Wie kann Gemeinschaft geschaffen werden?
Führung muss sich daran orientieren, wie Menschen ticken. Hier geht es nicht um die Erfüllung individueller Wünsche, sondern um das Eingehen auf die Natur des Menschen. Und um dies zu ermöglichen, muss Führung erstens verstehen, dass Engagement und Loyalität nur als Folge erlebter Gemeinsamkeit erreichbar sind, zweitens festlegen, dass Gemeinsamkeit das strategische Ziel und das Produkt von Führung ist und drittens handeln, indem Raum gegeben, zugehört und iterativ vorgegangen wird.
Kann es in einem Unternehmen überhaupt die eine Kultur geben oder sind Teilkulturen nicht viel realistischer? Meist fühlt man sich doch dem direkten Team viel verbundener als dem gesamten Unternehmen.
Wir sind gebaut für Strukturen von 10 bis 20 Menschen, die uns direkt umgeben. Dort entwickeln wir unverzüglich eine gemeinsame Kultur. Ab einer gewissen Größe, meist zwischen 20 und 50, brechen diese Strukturen auseinander und bilden Teilkulturen. Jeweils wieder mit eigenen Regeln und Ansichten. Wir leben heute nicht mehr in winzigen Dörfern. Dennoch bilden wir stets so etwas wie mentale Dorfgemeinschaften. Eine Organisation ist wie eine Region, die aus mentalen Dorfgemeinschaften besteht, aber eine bestimmte, gemeinsame Charakteristik aufweist. Die lokalen Besonderheiten der einzelnen Dörfer der Region bleiben dabei erhalten. Beides ist also wichtig: die Zugehörigkeit zu einem Team und die Eingebundenheit in ein größeres Ganzes.
Was ist erfolgversprechender: Die Kultur top-down oder bottom-up zu entwickeln?
Sowohl als auch. Die Führung muss sich des Themas glaubhaft annehmen. Sie ist dafür verantwortlich, dass überhaupt so etwas wie ein größeres Ganzes entstehen kann. Bloße Anwesenheit in einem großen Haus oder das Firmenlogo sind dafür zu wenig. Da muss emotionaler Inhalt rein. Und zwar so, dass sich sowohl die Individuen, als auch die Teilkulturen in ihm wiederfinden können.
Wenn es darum geht, die Unternehmenskultur zu gestalten, klingen manche Rezepte so banal. Warum ist es trotzdem oft so schwierig, sie umzusetzen?
Weil wir uns mit unserem Denken und den Theorien, die wir im Kopf haben, im Weg stehen. Und weil uns die alltägliche Hetze daran hindert, uns hinzusetzen und in Ruhe nachzudenken. Es fehlt an Phantasie, Reflexion und Strategie.