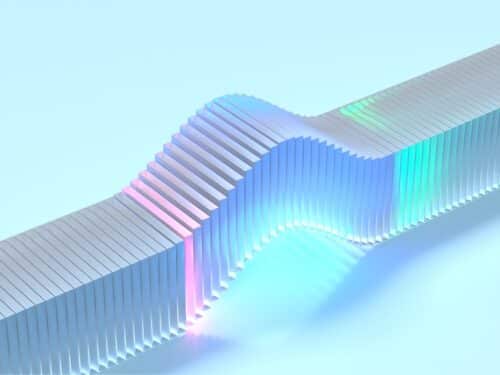Zeit seines Forscherlebens beschäftigt sich Michael Brater mit Themen der Ausbildungsforschung und Berufspädagogik. Im Interview erklärt er, was Ausbilder heute leisten müssen, welche Vor- und Nachteile das duale System hat und was Freiräume in der Ausbildung bewirken können.
Professor Brater, wie muss Ausbildung heute gestaltet sein, damit Jugendliche gerne und erfolgreich lernen?
Ich bin der Meinung, dass das schulartige Lernen immer weiter zurückgebaut und die Ausbildung im Betrieb, also in der Echtarbeit, immer stärker werden muss.
Warum?
Weil diese Art des Lernens eine wirkliche Alternative zum Lernen in der Schule ist und damit einen wichtigen Neuanfang bietet, der durch das Erleben und Mitmachen erfahrungsbezogen ist. Das bringt den Jugendlichen neue Motivationsschübe. Außerdem kann man gewisse Kompetenzen, wie die Fähigkeit, sich selbstständig unbekannte Fragestellungen zu erarbeiten, überhaupt nur so fördern. Betriebe müssen sich vom Vier-Stufen-Modell verabschieden, also der Ausbildung nach dem Muster „Erklären, Vormachen, Nachmachen, Üben“. Dafür muss man von außen möglichst optimale Bedingungen für das Lernen schaffen, zum Beispiel, dass sich der Lehrende als Lernbegleiter versteht und nicht als jemand, der einfach etwas mit dem Azubi einpaukt.
Das ist ein großer Anspruch an die Ausbilder im Betrieb.
Absolut. Und da gibt es natürlich ein Generationenproblem. Wenn jemand dreißig Jahre – gemessen an den Noten erfolgreich – im Unterweisungsstil ausgebildet hat, dann fragt der sich natürlich, warum er überhaupt etwas ändern soll. Aber die Arbeitswelt und deren Bedingungen haben sich nun mal geändert und werden es weiter tun. Man bildet ja nicht nur für den Moment aus, im Gegenteil. Junge Menschen haben ein langes Arbeitsleben vor sich und einen Anspruch auf optimale Förderung ihrer Kompetenzen. Und da man nicht auf Vorrat lernen kann, müssen sie auch die Fähigkeiten entwickeln, ihr Arbeitsleben immer wieder selbst zu gestalten.
Viele Ausbilder sind Naturtalente bei dieser Art der Vermittlung. Für die anderen gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten. Da gab es in den letzten Jahren einen großen Schritt nach vorne, beispielsweise mit der Verordnung für den geprüften Aus- und Weiterbildungspädagogen und für den geprüften Berufspädagogen.
Das Berufsfeld hat sich professionalisiert?
Bis 2009 gab es für Berufspädagogik gar kein Berufsbild, daher war das ein überfälliger Schritt. Denn bis zu diesem Zeitpunkt haben sich berufspädagogische Kompetenzen vielleicht aus Erfahrung gebildet, systematisch vermittelt wurden sie aber nicht. Heute frage ich mich manchmal, wie dieses System überhaupt funktionieren konnte angesichts der hohen pädagogischen Anforderungen, die das Ausbilden heute stellt. Denn Ausbilder müssen heute mit vielen neuen Herausforderungen fertig werden: Interkulturalität, heterogene Lerngruppen und steigende Theorieanforderungen sind da nur einige Beispiele. Leider stellen wir aber fest, dass die Wahrnehmung dieser Professionalisierungsmöglichkeiten relativ schwach ist. Es gibt zwar viele Angebote von Bildungsträgern, die meisten finden aber mangels Teilnehmern gar nicht statt. Die Betriebe unterschätzen die Wichtigkeit moderner berufspädagogischer Qualifizierung für ihr Ausbildungspersonal. Da geht es immer noch nach dem Motto: Ausbilden kann, wer gut in seinem Fach ist und ein Händchen für die Jugend hat. Das reicht aber schon lange nicht mehr.
Woran liegt dieses geringe Interesse der Betriebe?
Da spielt vor allem die Angst vor höheren Gehaltsforderungen eine Rolle. Und für manchen potenziellen Teilnehmer ist auch nicht klar, wie sich die berufspädagogische Weiterbildung bezahlt macht. Das verringert natürlich die Motivation.
Allerdings zeigt eine Umfrage, die wir unter geprüften Berufspädagogen durchgeführt haben, dass sie zwar nicht gleich befördert werden, aber dass sie zunehmend mit anspruchsvolleren und strategischen Aufgaben betraut sind und damit allmählich in neue Aufgaben hineinwachsen, die dann auch besser bezahlt sind.
Laut des aktuellen Azubireports sind viele Jugendliche zwar mit den Betrieben, aber nicht mit dem theoretischen Unterricht in der Berufsschule zufrieden. Warum?
Das wundert mich nicht. Denn wenn es nach der allgemeinbildenden Schule in eine Ausbildung geht, ist das für viele schulmüde Jugendliche eine Art Erlösung. In der Schule hatten sie vielleicht den Stempel, dass sie nichts können. Im Betrieb haben sie die Möglichkeit, sich neu zu bewähren und Anerkennung zu bekommen. Und dann finden sie sich doch wieder in einer Schule wieder.
Darüber hinaus sind Berufsschulen meist weniger gut ausgestattet und sehr viel träger als Betriebe, auch weil sie sich an Lehrpläne halten müssen, die mit den betrieblichen Veränderungen kaum Schritt halten können. Berufsschulen, die trotzdem ihre Freiräume zu nutzen wissen und ihren Unterricht stark aus der Praxis entwickeln, kommen besser an.
Deutschland heimst aber für die Ausbildung im dualen System immer wieder Lob ein. Ist das gerechtfertigt?
Das System hat tatsächlich enorme Vorteile. Die Tatsache, dass die Auszubildenden direkt Betriebsluft schnuppern und richtig mitarbeiten, ist durch verschulte Formen nicht ersetzbar. Man lernt eben viel mehr als nur das Fachliche. Ein großer Nachteil ist aber, dass die Ausbildung dadurch an betriebliche Interessen und wirtschaftliche Konjunkturen gekoppelt ist: Wenn der Betrieb sparen muss, geht das oft – kurzsichtig genug – zu Lasten der Ausbildung. Hier muss es ein System geben, das so etwas ausgleichen und überbrücken kann.
Wie könnte das aussehen?
Durch flexiblere Ausbildungsformen, in denen ein Jugendlicher auch vorübergehend in eine nicht-betriebliche Ausbildung eintreten kann und sobald wie möglich wieder in den Betrieb wechselt. Denn das muss das Ziel sein. Schlimm ist es, wenn Jugendliche so ins Übergangssystem abrutschen – was ja zurzeit viel zu häufig geschieht – und kaum Chancen haben, da wieder rauszukommen. Da stellen sich die Unternehmen mit der Mär von der fehlenden Ausbildungsreife oft selbst ein Bein.
Warum? Bieten diese Bildungsangebote nicht eine gute Möglichkeit, die Ausbildungsreife Jugendlicher zu fördern?
Das Übergangssystem ist vor allem dadurch entstanden, weil die Unternehmen in den letzten Jahren eine Bestenauslese vorgenommen haben. Mit dem sperrigen Begriff der fehlenden Berufsreife haben sie eine Art Azubi-Proletariat geschaffen, statt zu sehen, dass sie eigentlich besonders optimale Möglichkeiten haben, um Jugendliche, die mit dem schulischen Lernen nicht gut zurechtgekommen sind, zu fördern und aufzufangen. Stattdessen hat man gesagt, dass sie nicht gut genug für den Betrieb seien. Das Zusammenspiel zwischen dualem System und staatlicher Verantwortung ist hier einfach nicht gelungen.
Wie sieht dieses Zusammenspiel denn bestmöglich aus?
Grundsätzlich ist es ja so, dass der Staat nicht alleine, sondern nur in Kooperation mit Betrieben und Sozialpartnern agieren kann, und das sollte er auch tun. Ein Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Berufsbildern. Dieses Verfahren ist dadurch, dass so viele mitreden, kompliziert, aber das ist nun mal der Preis für Qualität. So werden die Ausbildungen besser und zeitgemäßer.
Was wäre ein Beispiel dafür, dass die Ausbildungsordnungen mit der Zeit gehen?
Eine schon erfolgreich erprobte Idee ist, den Betrieben mehr Freiräume zu lassen. Mal ein halbes Jahr innerhalb der Ausbildung gar nicht zu regeln, so dass der Betrieb diese Zeit nach seinen aktuellen Bedürfnissen gestalten kann. Dann ist der Betrieb in der Verantwortung, etwas Gescheites zu entwickeln und die Ausbildung wird flexibler und realitätsnäher.
Die Unternehmen werden demnach wichtiger bei der konkreten Ausgestaltung der Ausbildung?
Sie bekommen Veränderungen schneller mit, das ist natürlich ein großer Vorteil. Aber sie betrachten die Ausbildung manchmal zu sehr aus ihrer Perspektive. Die Stärke unserer Berufsbildungssystematik liegt darin, dass immer wieder versucht wird, nicht bei der einzelbetrieblichen Ebene stehen zu bleiben, sondern Kompetenzen zu vermitteln, die beruflich handlungsfähig machen, wie es im Berufsbildungsgesetz heißt. Das ist auch für die Flexibilität der Arbeitnehmer wichtig, damit sie nicht an einen Betrieb gebunden sind. Man muss also eine Balance finden zwischen dem Betrieb als Frühwarnsystem für Veränderungen und der Frage, ob das nur eine einzelbetriebliche Perspektive ist oder die Branche als Ganzes betrifft.