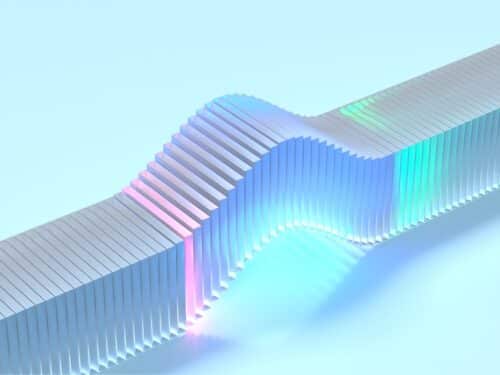China-Experte Frank Sieren über chinesische Überholmanöver, den Freizeitpark Europa und widerstreitende Auffassungen von Arbeitsethos und Management.
“Kein Schlaf, kein Sex, kein Leben“, unter diesem Titel erschien im April in der Honkonger „South China Morning Post“ ein Artikel, der die Arbeitszeitkultur „996“ anprangerte. Die Ziffern stehen für die gerade in Tech-Unternehmen üblichen Job-Zeiten: Geackert wird von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends, sechs Tage die Woche. Die Nachricht über einen wachsenden Widerstand junger Chinesen gegenüber extrem vereinnahmenden Jobs schwappte bis nach Europa und in die USA. Jack Ma, Alibaba-Gründer und damit Chef einer der größten IT-Gruppen Chinas, gab dazu das denkwürdige Statement: „Ich persönlich denke, dass es ein großer Segen ist, 996 arbeiten zu können.“
„Das Reich der Mitte ist ehrgeizig, schnell und gut organisiert und bestimmt zunehmend die internationalen Spielregeln“, schreibt der Journalist Frank Sieren in seinem kürzlich erschienenen Buch „Zukunft? China!“. Das Land setze auf Wachstum und digitale Technologien – und halte sich dabei nicht mit dem westlichen Demokratiemodell auf. Gerade letzterer Fakt sorgt für Unmut unter deutschen Unternehmern, auch mit Blick auf die geplante „Neue Seidenstraße“.
Bedroht die chinesische Mixtur aus Effizienz und Innovation unsere mitteleuropäische Arbeitskultur? Der seit 1994 in Peking lebende Handelsblatt-Korrespondent Sieren hat mit uns am Telefon über den Einfluss aus Fernost gesprochen.
Herr Sieren, weltweit wurde in den vergangenen Wochen spekuliert, inwiefern die junge Generation gut ausgebildeter Chinesen die dortige Arbeitskultur auf den Kopf stellt. Weil sie genug hat von Burn-outs vor dem 30. Geburtstag und Zwölf-Stunden-Tagen. Nehmen Sie in China wahr, dass die Stimmung umschlägt?
Frank Sieren: Ganz so einfach ist es nicht. Denn in China leben 1,4 Milliarden Menschen. Bis die Arbeitskultur eines solchen Landes auf den Kopf gestellt wird, muss schon ein wenig mehr passieren. Das, was Sie beschreiben, ist nur ein Teil der städtischen Eliten, der nun größer wird. Einen generellen Trend würde ich daraus nicht ableiten. Die meisten Menschen möchten weiterhin vom wirtschaftlichen Wachstum profitieren. Und wenn es sich für sie lohnt, arbeiten sie viel, um ihre Chance nicht zu verpassen. Die Aufbruchsstimmung ist prägend. Nun weniger als Fabrik der Welt als vielmehr in der Serviceindustrie oder sogar im Bereich der Innovation. In China entsteht gerade ein halbes Dutzend neuer Silicon Valleys. Teilen einer schon gesättigten Generation, die nun mehr auf Lebensqualität und Umweltschutz achtet, folgen Hunderte Millionen junger Menschen, die Karriere machen wollen. Die Ansprüche der chinesischen Arbeitnehmer wachsen, aber auf den Kopf stellt sich nichts.
Woran machen Sie das fest?
Fangen wir unten an: Selbst Wanderarbeiter sind inzwischen ein knappes Gut. Sie bleiben nur, wenn sie saftige jährliche Lohnerhöhungen bekommen, wenn das Essen stimmt und ihre Zimmer über Klimaanlagen verfügen. Dem unteren Management geht es heute immer mehr um Titel, Karrierechancen und Geld. Nur die Arbeiterschicht verlassen zu haben, reicht nicht mehr. Einer noch relativ kleinen Gruppe in den großen Städten ist, ähnlich wie in Europa und den USA, heute schon Flexibilität und eine vernünftige Work-Life-Balance wichtiger, als was sie auf dem Konto haben. Die meisten wollen jedoch schnell viel Geld verdienen. Und dafür sind sie bereit, wenn nötig alle paar Monate die Firma zu wechseln. Alles andere wäre auch ungewöhnlich in einem Land mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen von Bulgarien und immer noch über sechs Prozent Wachstum.
Dennoch tauschen sich Digital Natives international aus, bekommen über Auslandsaufenthalte und Social Media mit, wie sich die Arbeitskultur in Europa und Nordamerika flexibilisiert.Überall kommt langsam eine Generation ans Ruder, die anders tickt.
Ja – aber Europa und Nordamerika sind in einer anderen Entwicklungsphase. Die einst unangefochtene Tech-Hochburg Silicon Valley ist müde geworden. Die Chinesen kehren aus den USA zurück, ihre internationalen Teams nehmen sie gleich mit. Denn in China sitzt das Geld lockerer, die Menschen sind innovationsfreudiger, und man schafft es mit einem Start-up in der halben Zeit zum IPO. Das geht natürlich nicht, wenn man einen Nine-to-five-Job machen will. Inzwischen zahlen Unternehmen für gute, international ausgebildete chinesische Manager mehr als für den westlichen Expatriate, der sich erst in der Fremde zurechtfinden muss. Aber die kommen natürlich nur, wenn es ein Minimum an Lebensqualität gibt. Dazu gehören staatliche Hilfen für Start-ups ebenso wie saubere Natur oder eine Subkultur mit Künstlern, Bars und Restaurants. Das haben die neuen Start-up-Städte wie Shenzhen inzwischen verstanden. Aber vereinnahmend sind die Jobs schon noch.
Das Sättigungsgefühl, das zu einem Werteumbruch führen könnte, hat den Großteil der Menschen also noch nicht erreicht?
Nein. Die neue Freiheit besteht nicht im Wunsch nach einem Halbtagsjob, sondern darin, dabei zu sein, wenn neue Technologien und Services entwickelt werden, die globale Kreise ziehen. Die Aufbruchsstimmung transferiert sich bis in die Schulen. Es gilt eher das Prinzip: schnell, aber auch anspruchsvoll lernen statt lange viel spielen …
… und im Job lieber ein klangvoller Titel und ein schicker Wagen als freie Wochenenden und Familienzeit.
Ja. Zum Thema Zeit mit der Familie: Viele chinesische Kinder werden von den Großeltern aufgezogen, da beide Elternteile arbeiten möchten. Ob es ein weiteres Kind gibt, wird in manchen Familien so nüchtern besprochen, als ginge es um die Anschaffung einer neuen Schrankwand. Und meist haben die Großeltern keine Lust dazu. Deshalb werden nicht mehr Kinder geboren, obwohl die Ein-Kind-Politik längst abgeschafft ist. Die Kinder in der chinesischen Grundschule lernen im Vergleich zu Deutschland in doppelt so hohem Tempo. Schon in der ersten Klasse haben sie Englischunterricht. Wenn sie um 16 Uhr nach Hause kommen, machen sie rund anderthalb Stunden Hausaufgaben. Manche besonders ehrgeizigen Eltern schicken sie dann noch in den Geigenunterricht oder zum Taekwondo.
Die Zukunft der Arbeit liegt in Kreativität und Innovation. Solche Fähigkeiten giltes zu fördern, auch durch das Spielen. Kommt das in diesem eng getakteten Ablauf nicht zu kurz?
Das ist nicht ganz so einfach. Chinesen wachsen zum Beispiel mit der Fähigkeit auf, komplexe Strukturen auf einen Blick in einem Schriftzeichen zu erkennen. Das ist schon ganz nützlich fürs Leben. Es geht eben nicht nur um Drill, sondern um eine bestimmte Art des Denkens. Insgesamt ist die chinesische Kultur intuitiver. Die traditionelle chinesische Medizin zum Beispiel akzeptiert auch Behandlungen, von denen man weiß, dass die funktionieren, aber nicht warum. Das ist in Zeiten der künstlichen Intelligenz ein Vorteil, in denen es Entwicklungen geben wird, die wir nicht mehr nachvollziehen können, die aber sinnvoll sind. Dass Chinesen stur auswendig lernen und deshalb nur kopieren können, während wir kreativ sind, ist ein gefährliches Klischee, das den neuen globalen Wettbewerb unterschätzt. Das, was die Chinesen machen, wird wichtiger – auch für unsere Arbeitswelt. Sie setzen immer mehr die Maßstäbe.
Welche Unterschiede zu Deutschland beobachten Sie nach wie vor in der chinesischen Führungsmentalität?
Traditionell funktioniert Führung in China top-down, der Rang ist noch sehr wichtig. Das wird aber konterkariert von einer starken informellen Start-up-Bewegung. Dort macht in ganz flachen Hierarchien die beste Idee das Rennen. Nach einer Phase, in der jede Idee von jedem gefragt ist, läuft die Umsetzung unter dem Credo „Alles hört auf meinen Befehl“. Das bedeutet, Top-Manager müssen beides können. Große Unternehmen wie der Telekommunikationskonzern Huawei wurden dadurch erfolgreich, dass sie auf breite Einbindung der Mitarbeiter setzen, ihnen Spielraum geben. Der Gründer und sein Top-Management behalten jedoch am Ende die Zügel in der Hand. So ist es dem Konzern gelungen, zum größten Telekomausrüster der Welt zu werden. Diese eigenartige Mischung aus Kommandomentalität und freier kreativer Suche ist eines der Geheimnisse des chinesischen Erfolgs.
Allerdings zu dem Preis, dass Unternehmen regelmäßig gegen Arbeitszeitgesetze verstoßen. Werden Aussagen wie die von Alibaba-Chef Ma, Überstunden seien ein großer Segen, in der breiten chinesischen Gesellschaft diskutiert?
Die Mehrheit würde Ma zustimmen, eine wichtiger werdende Minderheit nicht. Was immer bedeutsamer wird: Die Chinesen möchten nun nicht alle weniger arbeiten. Sie möchten die Wahl haben, das zu tun oder zu lassen. Manche finden es erstrebenswert, Tag und Nacht zu arbeiten und sich mit 50 zur Ruhe zu setzen. Andere wollen noch mit 90 im Job aktiv sein. Manche möchten die Sicherheit des Angestelltenverhältnisses, andere in einem Start-up alles riskieren. Die Wahl ist die Freiheit. Und darüber wird ganz offen diskutiert.
In Ihrem Buch geht es darum, wie China den Rest der Welt herausfordert und internationale Spielregeln bestimmt. Wie verhält sich das mit Blick auf das Thema Arbeitsethos?
Die Epoche, in der die Minderheit des Westens die Spielregeln der Mehrheit der Welt bestimmen konnte, geht wahrscheinlich für immer zu Ende. Das betrifft natürlich auch das Thema Arbeitsethos. Wir im Westen haben zwei Möglichkeiten: Entweder akzeptieren wir den neuen globalen Wettbewerb und bekommen diese Mischung aus Kreativität und Ordnung genauso hin. Oder, ebenfalls legitim, wir klinken uns aus und sagen: Wir spielen das Spiel nicht mit. Dann sind wir wirtschaftlich weniger erfolgreich, haben weniger Geld und damit weniger Spielraum, unser materielles Leben zu gestalten. Aber vielleicht sind wir entschleunigt glücklicher im Freizeitpark Europa. Vielleicht.
In Deutschland hat sich das Tempo gerade eher verlangsamt.
Mit dem Ergebnis, dass wir Deutschen dabei sind, neue Innovationsschübe wie das Elektroauto mit seiner Batterietechnologie zu verpassen. Die Chinesen bauen derzeit eine Batteriefabrik in Deutschland, mit Technologie, die sie haben, wir aber nicht. Ist das der neue Trend? Wir müssen uns als Einzelne, aber auch als Deutsche, als Europäer überlegen, was wir wollen. Möchten wir international technologisch wettbewerbsfähig bleiben oder aussteigen? Fest steht: Mit unserem aktuellen Ausbildungsniveau, dem Innovationstempo und der veralteten Infrastruktur werden wir langfristig nicht mithalten können.
Die Bereitschaft zum Zwölf-Stunden-Tag wird sicherlich nicht größer. Auch scheint im Augenblick gesellschaftlich ein ökologisches Bewusstsein eher zu wachsen als das Bedürfnis nach „schneller, höher, weiter“.
Am Ende geht es dabei um Werte. Das Problem ist allerdings: Wenn wir technologisch abgeschlagen sind, werden wir nicht am Tisch sitzen, wenn die Wertesysteme der neuen multipolaren Welt ausgehandelt werden. Je weniger Geld wir verdienen, desto weniger Spielraum haben wir, uns bestimmte Lebensformen zu leisten. Da geht es am Ende auch um ein Gesundheitssystem, um die soziale Absicherung. Meine Sorge ist: Wir rutschen da rein, ohne uns über den globalen Wettbewerb und die Folgen für uns Gedanken zu machen.
Viele deutsche Unternehmen und Manager haben ein latentes Angstgefühl in Bezug auf China. Die Planung der „Neuen Seidenstraße“ verstärkt den Eindruck, es nähere sich eine Bedrohung. Halten Sie ihn für berechtigt?
Angst müssen wir nur haben, wenn wir nicht handeln. Die neue Seidenstraße birgt Gefahren, aber auch riesige Chancen. Bevor wir überhaupt auf europäischer Ebene eine Strategie entwickelt haben, haben die Chinesen bereits ein mit Brüssel unzufriedenes Land nach dem anderen für sich gewinnen können, weil sie dort innerhalb des Seidenstraßen-Projekts Milliarden in neue Infrastruktur investieren. Wir sind in der Defensive. Das passiert, während wir hoffen, dass ein neuer Arbeitsethos die chinesische Entwicklungsgeschwindigkeit bremst.
In Europa herrscht die Befürchtung vor, mit China keine gemeinsamen Spielregeln festlegen zu können, da sich die Wertesysteme fundamental unterscheiden. Das betrifft vor allem Umweltschutz, Datenschutz, Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit.
Und deshalb stecken wir lieber gleich den Kopf in den Sand? Oder hoffen, dass alle Chinesen nun lieber ein langes Wochenende machen und es schon nicht so schlimm kommen wird? Nein. Wir müssen uns mehr denn je auf gemeinsame Vorstellungen einigen und diese offen, aber mit großer Überzeugungskraft gegenüber den Chinesen vertreten. Wir müssen uns einbringen, wir müssen die neue Welt mitgestalten. Oder wir machen mit Europa, was die Engländer gerade mit Großbritannien machen: Wir klinken uns aus. Eines können wir nicht ändern, nämlich dass die Chinesen andere Vorstellungen haben als wir und sich von uns nicht mehr sagen lassen, wie sie zu leben haben. Meine größte Sorge ist gegenwärtig, dass wir gar nicht wissen, was wir wollen.
Wie geht es also weiter?
Bevor wir uns nicht klar werden, wie wir leben und arbeiten möchten, brauchen wir jedenfalls mit den Chinesen nicht zu verhandeln. Das gilt nicht nur für die Politik, sondern auch für moderne HR. Wir müssen eine Antwort auf die Frage haben, wie wir immer weniger arbeiten und trotzdem eine der führenden Wirtschaftsnationen der Welt bleiben wollen.

China-Experte und Handelsblatt-Korresporendent Frank Sieren lebt seit 1994 in Peking.