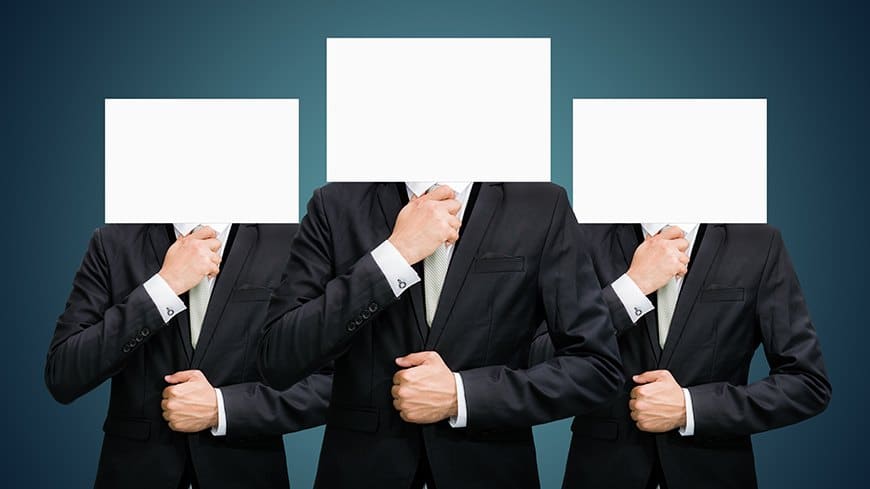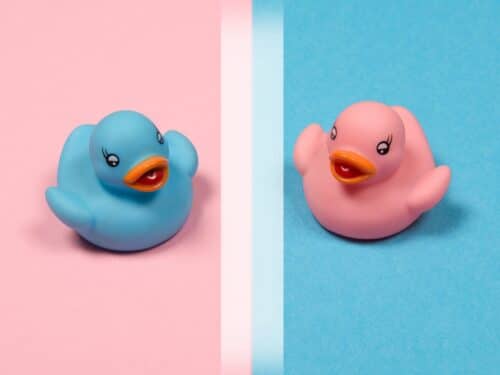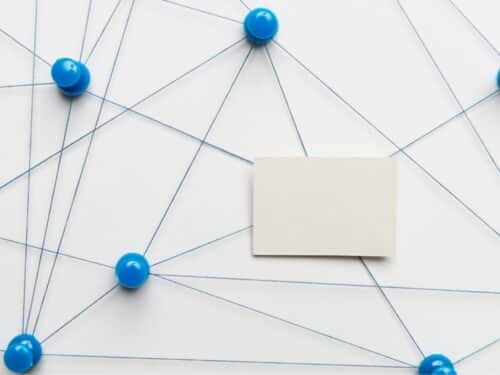Jobsuchende mit ausländischen Namen haben bei gleicher Qualifikation oftmals schlechtere Chancen als solche mit deutschem Namen. Bieten anonymisierte Bewerbungen einen Ausweg?
Mit einem Nachnamen wie meinem zeigen sich auf dem Arbeitsmarkt keine Vorbehalte. Gut, er klingt vielleicht nach Süddeutschland oder ein wenig nach Österreich. Aber das allein führt nicht dazu, bereits in der Vorauswahl aus dem Bewerbungsprozess zu fallen. Nein, Diskriminierung erleben jene Bewerber, deren Namen einen Migrationshintergrund vermuten lassen. Verschiedene Studien zeigen, dass mit einem türkischen Namen die Chancen auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch deutlich schlechter sind. Wer mit einem ausländisch klingenden Namen auf Jobsuche geht, muss trotz gleicher Qualifikation häufig zurückstecken.
Der Personalauswahl in Unternehmen pauschal Rassismus zu unterstellen, wäre jedoch zu weit gegriffen. Oftmals sind unbewusste Vorannahmen – sogenannte Unconscious Bias – für die Misere verantwortlich. Aber ob bewusst oder unbewusst: Die Benachteiligung von Bewerbern kommt vor – sei es der ausländisch klingende Name, das Alter oder das Geschlecht. Was also tun, um allen gleiche Chancen zu ermöglichen?
Unbewusste Entscheidungen
„Unconscious Bias sind eine Blackbox“, sagt Sebastian Bickerich, Pressesprecher der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Die Institution berät von Diskriminierung betroffene Personen und setzt sich mit Projekten für Chancengleichheit ein. Bei unbewussten Vorannahmen wisse man nie genau, um welche Vorurteile oder Stereotype es sich konkret handelt. Aber es gibt sie – immer dort, wo Menschen andere Menschen beurteilen. Und sie lassen sich nur schwer vermeiden. Neben Bewerbern mit ausländischem Namen seien auch häufig Frauen von Pauschalisierungen und Stereotypisierung betroffen. So wird ihnen schnell unterstellt, sie könnten schwanger werden und dann ausfallen. Dass Unternehmen jemanden im Gespräch diskriminieren, sei selten – dafür aber greifbarer, sagt Bickerich. Das Problem ist die unbewusste Diskriminierung, die zum Tragen kommt, wenn Arbeitgeber unter einer Vielzahl an Bewerbungen eine Vorauswahl vornehmen.
Wissenschaftler nehmen an, dass die deutliche Mehrheit der als diskriminierend wahrgenommenen Handlungen auf unbewussten Entscheidungen oder Anschauungen basieren, sagt Tim Weitzel, Professor für Wirtschaftsinformatik an der Universität Bamberg. Diese seien damit weder leicht steuerbar noch überhaupt bemerkbar. Viele Entscheidungen fällt der Bauch anstelle des Kopfes. Dem jeweiligen Entscheider ist dabei in der Regel nicht bewusst, welcher Teil einer als rational empfundenen Kopfentscheidung tatsächlich rational ist und welcher sich auf unbewusste Annahmen zurückführen lässt. Darüber hinaus spielt bei Entscheidungen auch die Vorbildfunktion von Vorgesetzten eine Rolle. Die Einstellung, mit der sie an die Personalauswahl herantreten, kann sich auf andere übertragen. Dazu zählen beispielsweise Äußerungen über bestimmte Personengruppen. Die Denkweisen und Handlungen von Vorgesetzten können das Arbeitsergebnis beeinflussen – positiv wie negativ.
Anonymisierte Bewerbungen
Unbewusste Vorannahmen haben auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft. Homogene Belegschaften und Personengruppen, die außen vor bleiben, sind eine Folge. Bickerich kennt die aktuelle Problematik am Arbeitsmarkt und die Herausforderungen für Bewerber mit ausländischem Namen. Schließlich ist die Situation nichts Neues. Bereits vor einigen Jahren initiierte die Antidiskriminierungsstelle ein Projekt für anonymisierte Bewerbungsverfahren. Über einen Zeitraum von zwölf Monaten haben unterschiedliche Großunternehmen Bewerbungen ausschließlich anonymisiert eingesehen und beurteilt. Das bedeutet: Die Unterlagen enthalten weder ein Foto, den Namen oder die Adresse noch Angaben zum Alter, dem Familienstand oder der Herkunft. „Mit dem Projekt wollten wir die Umsetzung von anonymisierten Bewerbungen in der Praxis testen“, sagt Bickerich. Schließlich sprechen sich viele Unternehmen gegen anonymisierte Bewerbungen aus und haben Vorbehalte. „Unser Ziel war es ebenso, dass der Recruitingprozess diskutiert wird.“
Anonymisierte Bewerbungen seien kein Allheilmittel, aber ein Instrument, das Diskriminierung mindert. Tendenziell profitierten im Rahmen des Projektes Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund. Sie haben in anonymen Verfahren in der Regel eine höhere Einladungswahrscheinlichkeit.
Teilnehmer des Projektes der Antidiskriminierungsstelle war unter anderem die Deutsche Post DHL Group. Im Bereich Nachwuchskräfte – Auszubildende und Trainees – erfolgte die Vorauswahl ein Jahr lang nur auf Basis anonymisierter Bewerbungsunterlagen. Um Anonymität zu gewährleisten, bearbeitete eine nicht entscheidungsrelevante Instanz alle eingehenden Unterlagen vor Sichtung durch die Personalabteilung. Dazu wurden diverse Angaben wie Geschlecht, Alter und Herkunft geschwärzt und Fotos entfernt. Ein enormer Arbeitsaufwand – vor allem in Anbetracht der Bewerberzahlen. Allein im Jahr 2018 erreichten die Deutsche Post DHL Group 36.000 Bewerbungen für Ausbildungsplätze. Mit der Teilnahme an dem Projekt wollte der Logistikdienstleister herausfinden: Kommt ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren zu besseren Ergebnissen als das bisher eingesetzte System? Die Antwort ist ernüchternd, wenngleich positiv: nein. Im Rahmen des Projekts gab es bei der Bewerberauswahl weder mehr noch weniger Frauen oder Kandidaten mit Migrationshintergrund als zuvor. Das hat den Verantwortlichen gezeigt, dass der aktuelle Bewerbungsprozess bereits über entsprechende Standards verfügt.
Automatisierung als Alternative
Das Unternehmen verzichtet seit dem Projekt auf anonymisierte Bewerbungsverfahren. Dass es bei der Vorauswahl zu Diskriminierung – insbesondere aufgrund unbewusster Vorannahmen – kommt, schließt Katrin Tremel, Teamleiterin Competence Center Recruiting bei der Deutsche Post DHL Group, nahezu aus. „Wir sind ein internationales Unternehmen, das sehr viele Nationalitäten beschäftigt“, sagt sie. Das sei in der Kultur und im Bewusstsein aller Beschäftigten stets präsent. Zudem zeige das Spektrum an Beschäftigten und Auszubildenden, wie divers die Belegschaft sei. Tremel hebt hervor, dass sie mit Vollzeit-Recruitern arbeiten, die sich nur mit ihrem Fachbereich befassen. Niemand erledige diese Aufgabe nebenbei. Die Recruiter sind in Sachen Diskriminierung sowie unbewussten Vorannahmen geschult. „Mit diesem Konzept haben wir in den letzten Jahren sehr gute Erfolge erzielt“, sagt Tremel.
Darüber hinaus hilft – vor allem im Bereich der Nachwuchskräfte – ein automatisiertes Bewerbermanagementsystem dabei, einen vorurteilsfreien Auswahlprozess zu gewährleisten. Das System übernimmt die Vorauswahl anhand von Abschluss- beziehungsweise Schulnoten. Bewerber, die den ersten Schritt meistern, kommen in die zweite Runde – ein Testverfahren. Zugang dazu erhalten sie automatisiert. Erst nach Bestehen des Testverfahrens bekommt ein Recruiter die Bewerbungsunterlagen zu Gesicht. Dieser prüft dann gemeinsam mit der ausbildenden Einheit die Eignung und lädt zu einem persönlichen Gespräch ein. „Gerade bei den ersten Schritten – besonders wegen der hohen Bewerberzahl – haben wir unbewusste Vorannahmen deutlich eingedämmt“, sagt Tremel.
Für operative Mitarbeiter wie Postzusteller greift das automatisierte System in dieser Form nicht. Aktuell plant die Deutsche Post aber auch dafür ein entsprechendes Bewerbermanagementsystem. Die Personalauswahl erfolgt oftmals in den Niederlassungen vor Ort. Um dort Diskriminierungen und unbewussten Vorannahmen vorzubeugen, schult das Unternehmen in diesem Jahr rund 500 Mitarbeiter. Darüber hinaus enthalten Fragebögen für Bewerber nur sachbezogene Fragen, die für die Personalauswahl relevant sind. Auf Angaben wie Geburtsland und -ort wird verzichtet. Grundsätzlich muss sich ein Unternehmen im Klaren darüber sein, an welchen Punkten im Recruiting-Prozess es zu Diskriminierungen kommen kann, sagt Tremel. Dieses Bewusstsein müsse regelmäßig geschärft werden.
Algorithmen gegen Diskriminierung
„Unsere Studien zeigen, dass für die Mehrheit der Unternehmen und Kandidaten die anonyme Bewerbung kaum eine Rolle spielt“, sagt Wissenschaftler Weitzel. Demnach sehen ältere Bewerber sowie die Mehrheit der Frauen in der anonymen Bewerbung nicht mehr Vor- als Nachteile. Interessanterweise seien jüngere Bewerber zwar ebenfalls mehrheitlich skeptisch, aber immerhin die Gruppe, die am ehesten Vorteile sieht. Als Alternative zur anonymen Bewerbung schlägt Weitzel einen klassischen Ansatz vor, nämlich eine heterogene Gruppe an der Bewerberauswahl zu beteiligen. Er merkt allerdings auch an, dass oftmals schon die Diagnose, ob und wie diskriminiert wird, schwierig ist.
Um den Bewerbungsprozess auf Diskriminierung zu prüfen, helfen statistische Verfahren. Diese können bei menschlichen Entscheidungen rückblickend oder bei maschineller Vorauswahl auch mithilfe von Testdaten per Simulation herausfinden, wie viele Personen mit welchen Eigenschaften in der Vorauswahl weiterkommen oder aus dem Prozess herausfallen.
Aber wie ist damit umzugehen, wenn sich herausstellt, dass diskriminierende Faktoren einen Einfluss haben? „Unternehmen sind in der schwierigen Situation, diese Sachfragen mit gesellschaftlichen Wertefragen zusammenzubringen, die emotional diskutiert werden und sich beständig ändern“, sagt Weitzel. Eine Überlegung wäre, Kandidaten wählen zu lassen, ob sie die Vorauswahl von einem Menschen oder einer Maschine vornehmen lassen wollen. Unabhängig von der Qualität der jeweiligen Alternative sei das Angebot ein Signal, dass Arbeitgeber Werte wie Fairness und Gleichbehandlung ernst nehmen. Für den Wissenschaftler deutet die aktuelle Debatte über mögliche algorithmische Fairness aber auch an, dass ebenso nicht ganz klar ist, wie Menschen- und Fairnessbild zusammenpassen. Die Frage sei, ob künstliche Intelligenz den menschlichen Bias imitiert oder ob sie ein Gegengewicht dazu bieten kann.