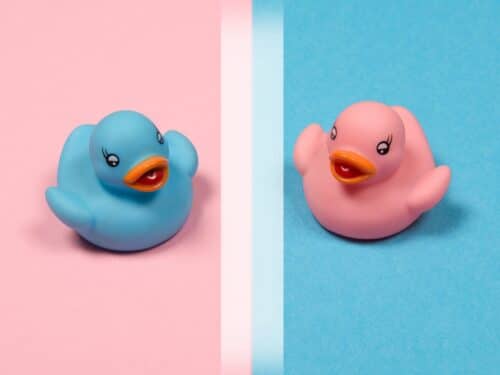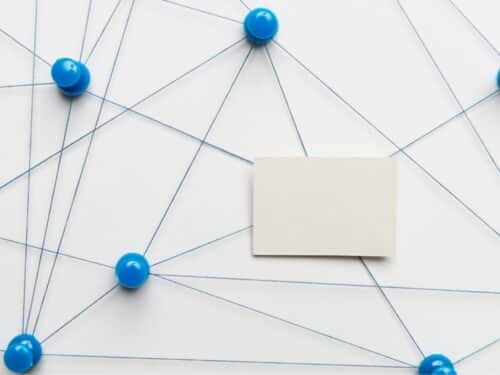Sprache hat sich immer schon über alle Länder und Epochen hinweg verändert. Sie ist Spiegel von Weltanschauungen, Machtverhältnissen und Ausdruck von Dazugehörigkeit (wir erinnern uns an die Déclaration des droits de l’homme, die in der Tat auch nur für diese galt: Männer, nicht Menschen). Sprache ist keineswegs neutral oder gar wertfrei. Victor Klemperer hat in seinem 1947 erschienenen und bis heute nichts an Dringlichkeit eingebüßten Werk zur Sprache des Nationalsozialismus konstatiert, dass Worte wie winzige Arsendosen sein können: „Sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da“. Dieses verbale Gift findet sich in Bezeichnungen von Personen, Lebensweisen und Situationen wieder. So sind Schulhofsprüche, die etwa Geschlecht oder die sexuelle Identität als Schimpfwort beinhalten (zum Beispiel „Bist Du schwul, oder was?!; „Heul doch nicht wie ein Mädchen!“) bewusste Abwertungen und Ausgrenzungen und reproduzieren – beabsichtigt oder nicht – Stereotype, die wiederum bestehende Ungleichheiten zementieren. So krass geht es zum Glück in der Unternehmenskommunikation nicht zu. Aber nur, weil dort diese extremen Ausformungen diskriminierender Sprache wegfallen, heißt es noch lange nicht, dass nicht dennoch zahlreiche Menschen – eigene Mitarbeiter*innen wie auch Kundinnen und Kunden – in der Ansprache regelmäßig exkludiert werden.
1. Der Nutzen einer inklusiven Sprache
Der persönliche Gebrauch einer inkludierenden Sprache ist immer Ausdruck eines Bemühens, dem Gegenüber mit einer offenen, aufgeklärten Haltung zu begegnen. Warum aber sollten Unternehmen eine inklusive Sprache verwenden, was haben sie davon? Durch eine inklusive Ansprache…
- lassen sich Zielgruppen stärker engagieren, da sie schließlich direkt adressiert werden,
- wird Kommunikation tatsächlich logischer und eindeutiger,
- vermittelt das Unternehmen ein positives und zukunftsgewandtes Bild von sich und
- werden sich schließlich auch mehr qualifizierte KandidatInnen bewerben
Der Verweis, dass sich Einzelne von bestimmten Äußerungen nicht diskriminiert oder ausgeschlossen fühlen („Frau Müller findet es übrigens auch nicht schlimm, wenn ich alle mit „liebe Kollegen“ anspreche, sie steht da voll drüber“), ist übrigens kein Maßstab oder Freifahrtschein, um an der sprachlichen Ausgrenzungspraxis nichts zu verändern. Auch reicht es nicht, wenn innerhalb von Unternehmen nur die Diversity-Abteilung die Exklusionsmechanismen von Sprache reflektiert. Vielfalt wirklich ernst zu nehmen bedeutet auch, dies in der Sprache zu spiegeln. Es besteht also ein ganz klares To-do in der internen wie externen Kommunikation, Verantwortung für die Inklusion der eigenen Kolleg:innen zu übernehmen. Erfreulicherweise muss niemand mehr das Rad neu erfinden – es gibt wirklich gute und praxisnahe Anleitungen zu rassismuskritischer, gendergerechter und inklusiver Sprache, wie beispielsweise
- Leitfaden für eine Genderinklusive und -gerechte Sprache der Prout-at Work-Stiftung
- Leitfaden zur Darstellung von Menschen mit Behinderung des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen
- Checkliste zum Leitfaden für einen rassismuskritischen Sprachgebrauch des Anti-Diskriminierungs-Büros Köln
2. Am Ball bleiben und im Zweifel einfach fragen
Bei allen Bemühungen um einen inklusiven Sprachgebrauch, ist es zugleich auch verständlich, dass nicht immer alle Begrifflichkeiten und deren Wirkung bekannt sind. Einfaches Fragen kann da helfen. So wurde ich nach meiner letzten Kolumne von mehreren Leser_Innen angesprochen, warum ich „Schwarze Menschen“ denn großschreibe und ob das wirklich der korrekte Terminus sei, also Schwarz (statt „farbig“ oder „dunkelhäutig“). In beiden Fällen: ja. Warum? Schwarz und Weiß werden tatsächlich großgeschrieben, um die sozialhistorisch durch den jahrhundertelangen Rassismus hervorgebrachte Kategorie auch sprachlich zu markieren. Alle anderen Beschreibungen wie „farbig“ oder „dunkelhäutig“ sind Fremdzuschreibungen. Weil „farbig“ bedeutet, dass alle anderen eine Farbe haben, nur wir Weißen eben nicht (das nennt sich dann auch „Othering“, das heißt die anderen zu anderen machen, während wir Weißen die „Norm“ sind, von der sich die „Farbigkeit“ anderer abhebt). Und „dunkelhäutig“ ist ähnlich: Was ist bitte dunkel? Und ab wann? Auch hier wird mit „Weiß“ von einer „Norm“ ausgegangen, von der andere abweichen.
3. Zu guter Letzt…
Im gesamten Text habe ich übrigens einmal alles verwendet: Gendersternchen, Doppelpunkte, Binnen-I, Unterstriche, Beidnennung. Welche Form ein Unternehmen schließlich wählt, ist am Ende gar nicht mal so entscheidend, wichtig ist eigentlich nur, dass die kommunikativen Möglichkeiten bewusst ausgeschöpft werden.
Weitere Beiträge aus der Kolumne:
Gesucht: Diversity Manager (m/w/d)
Diversity & Inclusion in Mitarbeiterbefragungen
Einstellungssache: Vorurteile im Recruiting minimieren
Qualität an die Spitze – Weg frei für die Geschlechterquote
Mehr als fair: Der Purpose von Diversity Management